Up In The Air
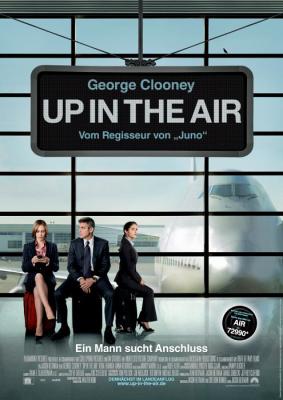 Ryan Air am Prüfstand. Ryan Bingham (George Clooney) hat einen gleichermaßen simplen wie auch enervierenden und anstrengenden Job: er schmeißt Leute auf die Straße, wenn die jeweiligen Chefs für das Aussprechen der Kündigung zu feige sind. Und Clooney geht mit einer nonchalanten und gleichzeitig distanzierten Art an diese Arbeitskräfte-Terminierung, dass es einfach nur amerikanisch sein kann: sogar im Teppich-unter-den-Füßen-wegziehen ist die Freiheit des einzelnen stigmatisiert, wenn sie mittels umfangreicher Neuanfangs-Dossiers "verkauft" wird, wie Bingham erklärt.
Ryan Air am Prüfstand. Ryan Bingham (George Clooney) hat einen gleichermaßen simplen wie auch enervierenden und anstrengenden Job: er schmeißt Leute auf die Straße, wenn die jeweiligen Chefs für das Aussprechen der Kündigung zu feige sind. Und Clooney geht mit einer nonchalanten und gleichzeitig distanzierten Art an diese Arbeitskräfte-Terminierung, dass es einfach nur amerikanisch sein kann: sogar im Teppich-unter-den-Füßen-wegziehen ist die Freiheit des einzelnen stigmatisiert, wenn sie mittels umfangreicher Neuanfangs-Dossiers "verkauft" wird, wie Bingham erklärt. Verträgliche Happen
"Up In The Air" könnte ein Film über das Corporate Amerika sein - ein Universum, das sich von sich selbst ernährt, das angesichts der Wirtschaftkrise nur unmerklich aus seiner Umlaufbahn manövriert wurde und sich doch fluffig leicht wie eine Daunenfeder wieder auf seine Ausgangsbasis zubewegt. Diese everything goes-Attitüde ist das Korrektiv für die verheerenden Ansagen, die Bingham seinen Klienten mit seinem gewinnenden Lächeln vor die Füße wirft. Dass die Kamera nicht länger draufbleibt, wenn mal wieder die Zeit für den Abschied gekommen ist, zeugt davon, dass Regisseur Jason Reitman die Sozialkritik eher in verträglichen Happen serviert denn als geballte Ladung. So bekommt der Streifen im Independent-Outfit den schalen Hollywood-Industrie-Beigeschmack.
I´m stereotype
Die Botschaft lautet wohl: Jobs sind Statussymbole, die zu verlieren die ultimative Katastrophe ist - sofern dieser Verlust eben nicht mit dem nötigen Brimborium als "Neubeginn" oder sogar als die Möglichkeit, endlich seinen lange gehegten Träumen nachzugehen, verkauft wird. Hier nimmt der Film auch die Wendung zur Love Story, wenn Bingham - dessen Leben als aseptischer Junggeselle voll ist von Platinkarten, Zusatzmeilen-Zielen und Stereotypen - in der Geschäftsfrau Alex (Vera Farmiga) eine verwandte Seele trifft, mit der es sich gut flirten lässt und die sich an die Regeln Binghams hält, wonach man sich von allem seelischen Bindungsballast befreien sollte - eine Einstellung, die er in seinen Motivationsseminaren predigt.
Change of plan
Dass Bingham am Schluß als Luftikus zum Sinkflug ansetzt, macht ihn zu einem ebenso passiv Beteiligten in diesem Spiel der chirurgisch sauber arbeitenden Kräfte wie all die Protagonisten der Bevölkerung, die er zuvor der Arbeitslosigkeit zuführte. Daran ist nicht so sehr die von ihm gönnerhaft belächelte Uni-Absolventin schuld, die er - ebenso wie die freizusetzenden Mitarbeiter - methodisch streichelweich wie ein Kind behandelt, nachdem sie sich dranmachte, ihm den Boden unter den Füßen zu entziehen. Daran ist vor allen Dingen Bingham selbst schuld, der merkt, dass er sich mit den von ihm selbst aufgestellten Regeln ins Ausgedinge manövriert. Und dank der zynischen Schlußpointe muss Clooney erkennen, dass sein kosmopolitisches Dasein nicht gegen ein Zwei-Zimmer-Haus mit Drei-Kopf-Familie einzutauschen ist.
cinematograph - 24. Mär, 14:20
